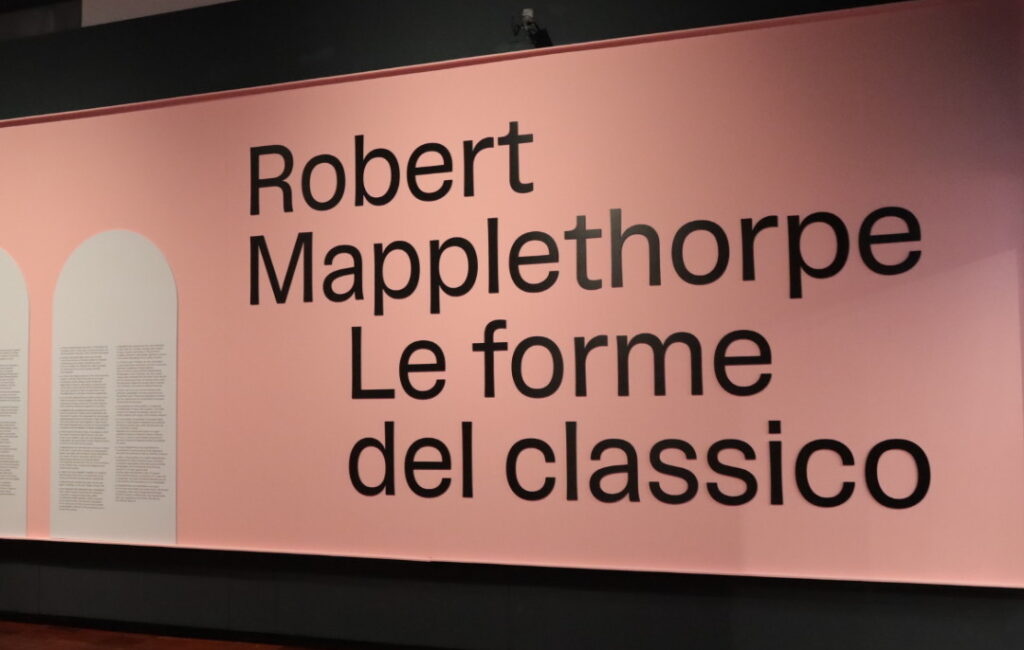
Es ist eine der Paradoxien der Fotogeschichte, dass ein Künstler, der in den 1970er- und 1980er-Jahren als Provokateur galt, heute in der kühlen Strenge der Museumsarchitektur beinahe wie ein Neoklassizist wirkt. Robert Mapplethorpe (1946–1989) war kein Dokumentarist und kein Chronist seiner Zeit, sondern ein Architekt von Körpern. Seine Fotografien – Männerakte, Frauenakte, Blumen, Porträts – sind Konstruktionen einer Formidee, die weit über die jeweilige Szene hinausreicht.
Geboren in Queens, New York, wuchs Mapplethorpe in einer katholischen Arbeiterfamilie auf und studierte am Pratt Institute in Brooklyn. Anfangs bastelte er Collagen aus Magazinfotos, bevor er mit der Polaroidkamera – einem Geschenk seines späteren Mentors Sam Wagstaff – zu seiner eigentlichen Sprache fand: präzise, kontrolliert, körperlich und zugleich distanziert.
Bekannt wurde Mapplethorpe durch seine Inszenierungen der New Yorker Subkultur: die Lederszene, Körperkulte, Machtspiele zwischen Lust und Kontrolle. Doch wer seine Arbeiten nur als Skandalgeschichte liest, übersieht ihren eigentlichen Kern. In der Spannung zwischen Begierde und Formdisziplin steht Mapplethorpe eher in der Tradition Michelangelos oder Ingres’ als jener der Reportagefotografie. Seine Männerakte – muskulös, ruhig, symmetrisch – wirken wie antike Statuen, deren Oberfläche im Licht glänzt wie polierter Marmor. Die Frauenakte hingegen, oft in Beziehung zu Blumen gesetzt, oszillieren zwischen Stärke und Verletzlichkeit, Idee und Körper.
„Whether it’s a cock or a flower, I’m looking at it in the same way … in my own way, with my own eyes“, sagte er einmal – und definierte damit sein künstlerisches Programm selbst.
In der Ausstellung auf San Giorgio wird das besonders deutlich: die große, fast sakrale Ordnung seiner Bilder, das Spiel aus Schwarz, Weiß und Licht, das die Körper aus der Zeit hebt. Mapplethorpe verleiht selbst den extremsten Szenen eine unheimliche Ruhe, eine Klarheit, die aus der Komposition kommt, nicht aus dem Thema. Er selbst sprach davon, dass Schönheit sein Endziel sei – ein Begriff, den die bürgerliche Kunstkritik ungern verwendet, weil er zu absolut klingt. Für ihn war Schönheit jedoch kein Ornament, sondern ein moralischer Imperativ: Kontrolle über das Chaos des Begehrens.
„I am obsessed with beauty. I want everything to be perfect, and of course it isn’t.“

Patti Smith: Symbiose aus Blick und Sprache
Bevor Mapplethorpe zu dem Fotografen wurde, den wir kennen, war er Teil einer anderen, intimeren Kunstgeschichte: jener der frühen 1970er-Jahre in New York, als er mit Patti Smith in einem winzigen Zimmer des Chelsea Hotels lebte. Beide jung, mittellos, getrieben vom Wunsch, Kunst zu machen. Smith arbeitete als Dichterin und Performerin, Mapplethorpe experimentierte mit Collagen und Schmuck. Ihre Beziehung war zuerst romantisch, dann freundschaftlich, schließlich fast geschwisterlich – eine gegenseitige Schule der Wahrnehmung.
Smith schrieb später in ihrem Buch Just Kids:
„Robert und ich hatten beschlossen, dass wir Künstler werden würden. Ich glaubte an ihn, und er glaubte an mich.“
Und weiter, in ihrem Abschiedsbrief an ihn:
„I learned to see through you and never compose a line or draw a curve that does not come from the knowledge I derived in our precious time together.“

Diese Verbindung prägte Mapplethorpes Blick dauerhaft. Patti Smith war sein erstes Modell, sein Spiegel und sein moralischer Kompass. In den frühen Porträts von ihr liegt noch kein Kalkül, nur Vertrauen. Sie gab ihm das Selbstbewusstsein, das er später in der kontrollierten Sprache des Studios perfektionierte.
Sam Wagstaff: Mäzen, Mentor, Liebhaber
Die zweite große Beziehung seines Lebens war die zu Sam Wagstaff (1921–1987), Kurator und Sammler, der Mapplethorpe 1972 kennenlernte. Wagstaff, gut dreißig Jahre älter, war in der Kunstwelt vernetzt und erkannte sofort das Potenzial des jungen Fotografen. Er schenkte ihm seine erste professionelle Kamera – eine Hasselblad – und öffnete ihm Türen zu Galerien, Sammler*innen und Förderkreisen. Zudem schenkte er Mapplethorpe
Doch ihre Verbindung war nicht bloß ökonomisch. Wagstaff verstand Mapplethorpes Drang nach Kontrolle, nach makelloser Oberfläche. „He made me see the eroticism of the formal,“ schrieb Wagstaff einmal über seine Faszination für Mapplethorpes Arbeiten Zwischen beiden entstand eine symbiotische Dynamik: Wagstaff sammelte obsessiv historische Fotografien, Mapplethorpe formte aus der Gegenwart neue Klassiker.
Ihre Partnerschaft war von Zärtlichkeit und Disziplin gleichermaßen geprägt – zwei Männer, die im puritanischen Amerika der 1970er-Jahre Schönheit und Begehren als ernste, fast religiöse Themen behandelten. Als Wagstaff 1987 an AIDS starb, zwei Jahre vor Mapplethorpe, fiel dessen Werk in eine melancholische Ruhe. Viele seiner letzten Stillleben – Lilien, Orchideen, leere Vasen – wirken wie elegische Requien auf diesen Verlust.
Als Mapplethorpe 1989 mit nur 42 Jahren starb, hinterließ er ein Werk, das zugleich zeitgebunden und überzeitlich ist. In einer Ära, die sich am Skandal festbiss, bestand er darauf, dass die Form wichtiger sei als das Motiv – und dass jede Fotografie, so körperlich sie auch sei, letztlich eine Frage der Linie ist. Vielleicht ist das das Geheimnis seiner anhaltenden Wirkung: dass in seinen Akten, ob männlich oder weiblich, nie das Fleisch triumphiert, sondern immer der Blick.

Der Cincinatti-Skandal: Kunst, Moral und Klassenjustiz
1990 erreichte die Kontroverse um Robert Mapplethorpe ihren Höhepunkt – posthum, ein Jahr nach seinem Tod an den Folgen von AIDS. Die Ausstellung „The Perfect Moment“, die zuvor in Philadelphia und Chicago gezeigt worden war, sollte in Cincinnati, Ohio, in den Räumen des Contemporary Arts Center (CAC) eröffnet werden. Die Schau umfasste über 150 Fotografien, darunter Porträts, Blumenstudien und – im hinteren Teil – eine Serie explizit homoerotischer Bilder aus der New Yorker S/M-Szene der späten 1970er Jahre. Es waren diese letzten, sogenannten „X-Portfolio“-Arbeiten, die den Skandal auslösten.
Die lokale Staatsanwaltschaft beschuldigte das Museum und dessen Direktor Dennis Barrie, „obszöne Materialien“ ausgestellt zu haben – ein Vorwurf, der nach US-amerikanischem Recht eine strafrechtliche Anklage bedeutete. Die Polizei beschlagnahmte Teile der Ausstellung, obwohl das Museum die Altersgrenze von 18 Jahren strikt einhielt. Der Fall kam vor Gericht: The State of Ohio v. Contemporary Arts Center and Dennis Barrie.
Im Lauf des Prozesses standen zwei Fragen gegeneinander: Was ist Kunst – und wer definiert sie? Der Jury wurden großformatige Abzüge von Mapplethorpes Bildern gezeigt, während Kunstexpert*innen erklärten, dass der Künstler in der Tradition klassischer Aktfotografie stehe, mit einer formalen Strenge, die an Renaissance-Kompositionen erinnere. Am 5. Oktober 1990 sprach das Gericht das Museum und seinen Direktor frei. Es war der erste Prozess in der US-Geschichte, bei dem ein Museum wegen angeblicher Obszönität angeklagt war – und zugleich ein seltener Sieg der künstlerischen Freiheit.
Doch der Skandal hatte seine Schattenseite. Er markierte den Beginn der sogenannten „Culture Wars“ in den USA, die in den 1990er Jahren immer aggressiver geführt wurden: rechte Politiker und evangelikale Gruppen griffen staatliche Kunstförderungen an, insbesondere das National Endowment for the Arts (NEA). Senator Jesse Helms, einer der lautesten Kulturkämpfer, nutzte Mapplethorpe als Symbol für die „Dekadenz“ einer angeblich von Homosexualität und Relativismus vergifteten Moderne.
Mit dem Cincinatti-Skandal war der ideologischer Klassenkampf endgültig auf kulturellem Terrain angekommen. Während der Kapitalismus in den USA in eine neue Phase von Deregulierung und Austerität eintrat, versuchte das Bürgertum, den gesellschaftlichen Widerspruch zwischen einer formal garantierten „Freiheit der Kunst“ und der realen moralischen Kontrolle durch Staat und Markt zu verwischen. Mapplethorpes Arbeiten waren dabei nicht „anstößig“ im vulgären Sinn, sondern gefährlich, weil sie Macht und Begehren, Körper und Identität jenseits der bürgerlichen Norm sichtbar machten. Die Kombination aus technischer Perfektion und radikalem Inhalt sprengte die Grenzen des „Ästhetisch Erlaubten“.
Die Kunstkritikerin Janet Kardon, Kuratorin der Ausstellung, formulierte es rückblickend so:
„Mapplethorpe’s work confronted America with what it refused to see — the beauty of the male body, the eroticism of power, and the fact that desire itself is political.“ (Interview in: The Guardian, 6. April 2019)
Nachhall: Die Kulturkriege und die bürgerliche Moral
Der Freispruch von 1990 war kein Ende, sondern der Auftakt eines neuen Kapitels. In den Jahren danach wurde Mapplethorpe – posthum – zur Symbolfigur einer Polarisierung, die weit über die Kunst hinausreichte. Die amerikanische Rechte erkannte, dass kulturelle Fragen ein wirksames Vehikel sind, um gesellschaftliche Unsicherheiten politisch zu instrumentalisieren. So begannen die sogenannten „Culture Wars“, in denen Themen wie Abtreibung, Queerness, Religion und Kunst zu ideologischen Schlachtfeldern wurden.
Künstlerinnen wie Andres Serrano, dessen Fotografie Piss Christ (1987), oder Nan Goldin, die das Leben von Drogenabhängigen, Queers und Sexarbeiterinnen dokumentierte, wurden nun zu Zielscheiben derselben Moraloffensive. Im Mittelpunkt stand immer wieder die Frage, ob Steuergelder über das National Endowment for the Arts (NEA) für „anstößige“ Kunst verwendet werden dürften. Die konservative Mehrheit im Kongress griff die öffentliche Kunstförderung systematisch an – ein Angriff, der zugleich die Autonomie der Kunst und die materielle Grundlage kritischer Kulturproduktion bedrohte.
Diese ideologische Offensive hatte eine klare soziale Funktion. In einer Phase wachsender Ungleichheit und der Deindustrialisierung des US-Kapitals diente die moralische Empörung als Ablenkungsmanöver. Statt über Löhne, Gewerkschaften oder soziale Rechte zu diskutieren, wurde das „Sittliche“ zur Ersatzarena politischer Kämpfe. Die herrschende Klasse versuchte, die kulturelle Hegemonie zurückzuerobern, indem sie die Begriffe von „Ordnung“ und „Anstand“ neu besetzte – gegen jene, die gesellschaftliche Machtverhältnisse sichtbar machten und dadurch in Frage stellten.
Gleichzeitig erfuhr Mapplethorpes Werk in der Kunstwelt eine Umwertung. Was in Cincinnati kriminalisiert worden war, hing bald in den großen Museen: im Whitney, im Guggenheim, in der Tate Modern. Der Diskurs kippte vom Skandal zur Kanonisierung. Der amerikanische Philosoph Arthur C. Danto schrieb 1995 in der “Nation”:
„Mapplethorpe’s photographs, like Caravaggio’s paintings, demonstrate that beauty and transgression are not opposites but two aspects of the same truth.“ Damit war der Kreis geschlossen: Der bürgerliche Kunstbetrieb vereinnahmte, was er zuvor ausgegrenzt hatte.
Doch unter der glänzenden Oberfläche bleibt die gesellschaftliche Spannung bestehen. Mapplethorpes Bilder, mit ihrer formalen Strenge und erotischen Direktheit, erinnern bis heute daran, dass Ästhetik keine Flucht aus der Realität ist, sondern deren präzise Spiegelung – im Spiel von Licht und Schatten, Macht und Begehren, Schönheit und Gewalt.
Europa: Ästhetik, Körper, Freiheit
In Europa verlief die Rezeption Robert Mapplethorpes von Beginn an anders als in den USA. Während die amerikanische Debatte von puritanischer Moral und politischen Kulturkämpfen durchzogen war, stand hier die Formfrage im Vordergrund: die vollkommene Beherrschung von Licht, Komposition und Kontrast. Die frühen Ausstellungen in Paris (Centre Pompidou, 1983), Düsseldorf (Kunsthalle, 1984) oder London (Hayward Gallery, 1988) präsentierten Mapplethorpe nicht als Provokateur, sondern als klassischen Bildhauer mit der Kamera, der die antike Idealisierung des Körpers in die Gegenwart überführte.
In Frankreich schrieb Philippe Sollers 1989 in Le Monde:
„Mapplethorpe a retrouvé la sculpture à travers la photographie. Son art n’est pas obscène, il est platonicien.“ („Mapplethorpe hat über die Fotografie die Skulptur wiedergefunden. Seine Kunst ist nicht obszön, sondern platonisch.“)
Dieser Satz markiert den fundamentalen Unterschied zur US-Rezeption: Wo der amerikanische Staat das Obszöne zu kriminalisieren suchte, sah das europäische Feuilleton darin eine Rückkehr zur Idee des Schönen – jenseits moralischer Kategorien.
Auch in Deutschland, wo die Auseinandersetzung mit Körper, Macht und Sexualität durch den intellektuellen Nachhall der 68er-Bewegung geprägt war, stieß Mapplethorpe auf analytisches Interesse. Die wohl nicht gerade als Herold der Moderne verschriene “Frankfurter Allgemeine Zeitung” nannte seine Arbeiten 1992 „eine neue Grammatik des Begehrens“; in der “taz” sprach man von einem „antiken Perfektionismus, der die Brüchigkeit des Begehrens nicht leugnet, sondern ihr Form gibt“.
In Großbritannien, wo die Fotografien 1988 im Institute of Contemporary Arts (ICA) zu sehen waren, hob man Mapplethorpes Verhältnis zur klassischen Moderne hervor – seine Nähe zu Man Ray, Weston oder Herbert List, aber auch seine Abweichung: die kalkulierte Kälte der Oberfläche, die zugleich Distanz und Intimität schafft.
So wurde Mapplethorpe in Europa weniger als Skandalon, sondern als Grenzgänger zwischen Antike und Moderne gelesen – ein Künstler, der das klassische Ideal des Körpers beibehielt, aber dessen gesellschaftliche und erotische Codierung veränderte.
Epilog: Licht, Marmor, Venedig
In den Stanze della Fotografia auf San Giorgio wird in einer fast klösterlichen Atmosphäre bis 6.1.2026 eine große Mapplethorpe-Werkschau gezeigt. Das Licht gedämpft durch die Höhe des Raums und die Holzkonstruktion der Decke, die Schwarzweißabzüge Mapplethorpes thematisch auf farbigem Untergrund präsentiert. Keine lauten Farben, kein Spektakel, nur das präzise Verhältnis von Licht zu Schatten, Körper zu Form, Kontrolle zu Begehren.

Sitzgruppen laden dazu ein, die Fotografien wirken zu lassen. Zu erkennen, wie perfekt Mapplethorpe mit Licht und Schatten gearbeitet hat.
Es ist diese Strenge, die seine Bilder so gegenwärtig macht: Sie sind nicht erotisch im trivialen Sinn. Der Körper erscheint bei Mapplethorpe nicht als Objekt der Lust, sondern als Ort einer ästhetischen Wahrheit — als etwas, das aus der Dunkelheit geformt wird wie eine Idee aus der Materie.
Dass ausgerechnet in Venedig, dieser von Wasser und Verfall umschlossenen Stadt, Mapplethorpe so klassisch wirkt, ist kein Zufall. Hier, wo alles Schöne buchstäblich vom Untergang bedroht ist, entfalten seine Akte eine fast antike Ruhe. Sie behaupten eine Ordnung, die es in der Welt längst nicht mehr gibt — eine Ordnung der Form, nicht der Moral. Und vielleicht liegt gerade darin ihre politische Kraft: in der Weigerung, zwischen Schönheit und Wahrheit zu unterscheiden. In derEin eigener Bereich ist den beeindruckenden Porträts gewidmet. Dialektik von Form und Freiheit, Licht und Dunkel, Erotik und Tod verkörperte er jenen Moment, in dem das Bürgerliche noch einmal schön sein will, obwohl es seinen eigenen Untergang längst spürt.
Kurt Lhotzky


