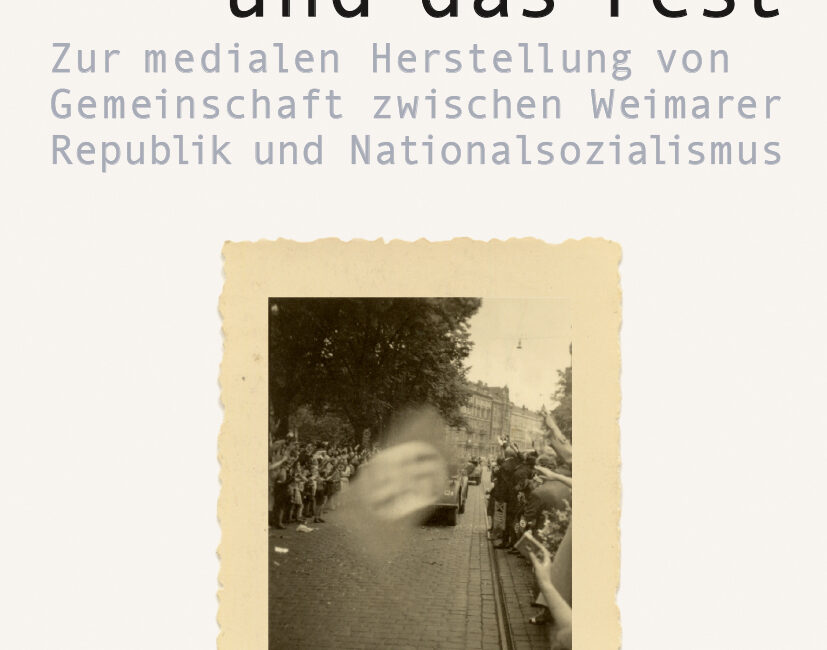
Linda Marie Conze legt mit Die Fotografie und das Fest ein Buch vor, das nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Fotografiegeschichte leistet, sondern zugleich tief in die politischen, ideologischen und sozialen Dimensionen des Mediums eindringt. Sie analysiert, wie Fotografie nicht bloß „Prozesse abbildet“ – eine altbekannte These –, sondern selbst aktiv an der Gestaltung gesellschaftlicher Wirklichkeit teilhat. Conze zeigt eindrücklich, dass das Bild nicht nur dokumentiert, sondern das Gemeinsame sichtbar macht und als Referenzpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzung fungiert.
Ihre Quellenbasis ist bemerkenswert: Conze stützt sich vor allem auf Amateurzeitschriften wie Photofreund und die Agfa Photoblätter, deren Jahrgänge von 1927 bis 1937 eine Art Seismograph der fotografischen Kultur jener Zeit darstellen. Hier eröffnet sich ein faszinierender Blick auf Fotografie als Massenpraxis: Zeitschriften wurden nicht nur als Informationsmedien genutzt, sondern als Orte lebhafter Interaktion – fast modern gesprochen: „community-zentrierter Journalismus“. Rubriken wie die weit verbreitete „Bildkritik“ zeugen vom partizipativen Charakter, von einer frühen Form dessen, was man heute „Prosumer“-Kultur nennen würde.
Dazu einer meiner Lieblingssätze: “Und da, wo Disharmonie herscht, wird es für Historikerinnen und Historiker interessant.” (S.52)
Der Zeitraum von zehn Jahren ist keineswegs zufällig – die Autorin interessiert sich für den Übergang von der Weimarer Republik in die ersten Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft, jene Zeit also, in der sich die „Volksgemeinschaft“ formierte – oder formiert wurde.
Besonders spannend sind die Debatten um Amateurfotografie und die damit verbundenen Schlagworte „Natürlichkeit“ und „Erleben“. Diese Begriffe – aufgeladen mit biologistischen Konnotationen – können nicht zufällig von der faschistischen Ideologie „adoptiert“ werden, die Authentizität, Ursprünglichkeit und kollektives Erleben beschwört. Dass „Natürlichkeit“ hier letztlich als Effekt entlarvt wird, als Inszenierung des Ungezwungenen, ist eine der subtilen Einsichten Conzes. Das scheinbar schlichte Festfoto – Ostern, Weihnachten, Karneval – wird damit zu einem ideologischen Kristallisationspunkt: Erinnerung und Gemeinschaft verschränken sich mit ästhetischen Konventionen und politischen Weltanschauungen.
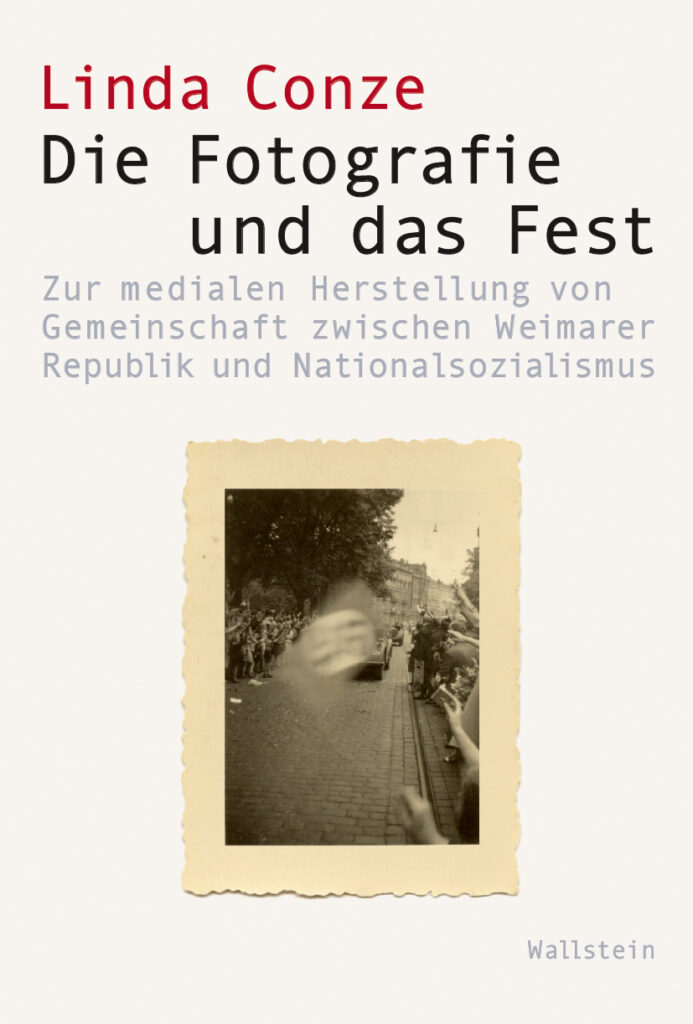
Conze gelingt es, technische Innovationen, ästhetische Debatten und politische Umbrüche miteinander zu verweben. So verweist sie auf eine bemerkenswerte Gleichzeitigkeit im Jahr 1933: Machtantritt der Nationalsozialisten und Einführung effizienterer Blitzlampen, die Innenraumfotografie populär machten. Diese Gleichzeitigkeit ist kein bloßer Zufall, sondern verweist auf die wechselseitige Bedingtheit von technischer Entwicklung und gesellschaftlichem Umbruch. Dass die Nazis explizit eine „deutsche Fotografie“ forderten und Begriffe wie „Weltanschauung“ in den Bilddiskurs einschleusten, unterstreicht die ideologische Vereinnahmung eines Mediums, das gemeinhin als „universal verständlich“ galt.
Doch Conze betont zugleich die Ambivalenz: Fotozeitschriften waren Orte der Auseinandersetzung, Disharmonie, Widerspruch – und gerade das macht sie für die Geschichtswissenschaft so interessant. Wenn Redaktionen Regeln als „Extrakt aus Erfahrung vieler Generationen“ verteidigten, dann geschah dies in Abgrenzung zu jenen, die experimentierten, Regeln brachen und den Anspruch der „Knipser“ übertrafen. Bauhaus-Schüler forderten 1929 explizit, Regeln zu sprengen – und gerade hier verschränkt sich Avantgarde mit populärer Praxis.
Auch die Rolle der Fotografie für Erinnerung und Vergemeinschaftung wird klar herausgearbeitet. Vom „Volksfototag“ 1927, von den Fotohändlern zur Ankurbelung der Amateurfotografie inszeniert, bis zur „fotografierten Familienchronik“ 1934: Fotografien wurden als visuelle Stammbücher begriffen, als Ankerpunkte familiärer und kollektiver Erinnerung. Das Album des Wehrmachtssoldaten diente ebenso der Positionsbestimmung in der „Volksgemeinschaft“ wie die Reportage über den „Rassenschande-Umzug“ in Marburg im August 1933 Die Straße selbst wurde, wie Conze zeigt, zu einem „Massenmedium“, das Fotografie fortsetzte und transformierte.
Das Faszinierende an Conzes Buch ist, dass es sowohl die Mikroebene – das einzelne Bild, die Leser*innenreaktion – wie auch die Makroebene – politische Ideologien, gesellschaftliche Umbrüche – zu verknüpfen vermag. Ihre Analyse macht deutlich, dass Fotografie im frühen 20. Jahrhundert weder neutral noch unschuldig war, sondern zutiefst in soziale Praktiken, Machtverhältnisse und Ideologiebildung eingebunden. Damit liefert sie nicht nur Fotohistoriker*innen, sondern auch Kultur- und Ideologiehistoriker*innen reiches Material.
Die Lektüre ist spannend und anregend, weil Conze die Vielschichtigkeit von Amateurfotografie sichtbar macht: Sie war Erinnerungsspeicher, ästhetisches Experimentierfeld, ideologisches Instrument und populäres Forum zugleich. Wer die Rolle der Fotografie in der „Volksgemeinschaft“ verstehen will – und zugleich begreifen möchte, wie scheinbar banale Bilder ganze Weltanschauungen transportieren –, kommt an diesem Buch nicht vorbei. Mitunter wünschte ich mir nur einen etwas „englischeren“ Zugang beim Formulieren. Einige Passagen fand ich etwas sperrig formuliert. Das ist nun aber ein sehr subjektiver Kommentar, der niemand von der Lektüre dieses exzellenten Werkes abhalten soll.
Kurt Lhotzky
Linda Conze
Die Fotografie und das Fest
Zur medialen Herstellung von Gemeinschaft zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus
Wallstein Verlag
340 S., 194 Abb.€ 44,00 (D) / € 45,30 (A)
Beitragsbild: Buchcover, mit freundlicher Genehmigung des Verlags



This article brilliantly explores the deep connection between photography, community, and ideology during a pivotal historical period. The analysis of amateur photography as both a personal and political tool is fascinating. Highly insightful!